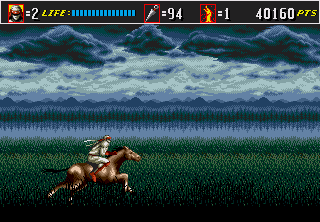Im NDR-Zweiteiler „Hamburger Schule – Musikszene zwischen Pop und Politik“, zu sehen in der ARD-Mediathek, soll der Hamburger Schule auf den Zahn gefühlt werden. An sich eine gute Sache, für viele wird dies einen ersten Berührungspunkt mit der Bewegung darstellen. Aber ist es eine passende Einleitung in die Thematik? Und sind rund 60 Minuten wirklich zu wenig Zeit, um ein vielschichtiges Bild der Szenerie zu zeichnen? Leider gestaltet sich das Format derart unterkomplex und fragwürdig, dass man sich zwangsläufig fragen muss: Woran hat es bloß gelegen?
Die Regisseurin Natascha Geier zeigt sich perplex darüber, dass Dirk von Lowtzow seine Texte einst auf Englisch schrieb und sie einfach auf Deutsch übersetzte, woraus sich ein gewisses komisches Potential erschloss. Wie oft bitte hat man schon diese Anekdote von dem ersten lyrisch-musikalischen Material der Band Tocotronic gehört? Unzählbar. Und gerade zuletzt noch in der sehr ausführlichen Podcast-Reihe über die Band, produziert von rbb und NDR. Momente der Selbstoffenbarung wie diese, die unmittelbaren Einblick in eine mangelnde Recherche vermitteln, gibt es hier viele. Dieses Fehlen von journalistischer Arbeit soll damit kompensiert werden, dass die Filmemacherin selbst zur Blütezeit der Hamburger Schule in der Stadt war und so manches Konzert besuchte, mit Szene-Promis am Tresen saß oder auch mal bei einem Goldenen-Zitronen-Video mitwirkte.
Was man dem Beitrag allgemein vorwerfen kann, ist das Verlassen auf anekdotische Evidenz. Diese mag auch ihre Berechtigung haben, das ganze Werk dann aber unter dem Hamburger-Schule-Label zu vermarkten, ist grenzwertig. Allgemein ist die Dramaturgie der Aufmachung recht assoziativ gehalten. Wenn es gerade einmal um Geld geht, wird ein Zitat von Rocko Schamoni eingeblendet: „Geld ist eine Droge“. Und das ist noch eines der stärkeren Beispiele.
Dabei sind viele der Interview-Partner großartig. Dem Titel nach soll es also auch um Politik gehen. Was hätte Frank Spilker als politischer Mensch, der er ja nun einmal ist, alles zu den rechtsradikalen Ausschreitungen von Hoyerswerder oder Lichtenhagen sagen können? Hat man ihn denn gefragt? Sieht jedenfalls nicht danach aus. Stattdessen sehen wir die schrecklichen Dokumente der jungen wiedervereinten Bundesrepublik und Jan Müller daraufhin nur knapp erklären, dass er das nicht gut findet. Viel mehr Politik ist jedenfalls nicht zu finden. Es ist schwer vorstellbar, dass die Interviewten, wenn sie denn überhaupt auf die Verzahnung von Kunst und Politik angesprochen wurden, wirklich die Gelegenheit hatten, ausführlich ihr Standing auszuführen. Selbstredend kann es auch sein, dass viel gutes Material der Schere zum Opfer gefallen ist. Dann aber hat man sich für die falschen Zitate entschieden.
Höchst uninspiriert erscheinen die Einspieler, in denen Auszüge aus TV-Auftritten und Berichterstattungen thematisierter Bands gezeigt werden. Ja, Tocotronic war einst bei Top of the Pops und hat sich beim Auftritt selbst nicht ernst genommen. Ja, sie haben auch den deutschtümelnden Viva-Nachwuchspreis sympathischerweise abgelehnt. Und ja, es wurde im Kleinen auch über das Phänomen jüngerer deutschsprachiger Bands aus dem Hamburger-Schule-Kosmos in den 90ern im Mainstream berichtet, gerne mit ironisch distanziertem Tonfall. Aber wo bitte führt diese Auswahl des Materials hin, das immer den gleichen Kontrast aufweist, dass Fernsehformate und die Musik sich nicht verstanden haben? Warum wurde nicht der angedeutete Diskurs, der im Spex-Kosmos stattfand und sehr viel relevanter war, aufgenommen? Zu unbequem? Angst vor einer Alexander-Kluge-Ästhetik?
Während eine der zentralen Figuren der Hamburger Schule, Bernd Begemann, radikal wegignoriert wird, trifft es Jochen Distelmeyer noch härter: Sein Blumfeld-Spätwerk wird unter anderem mit Max Giesinger und den sogenannten neuen deutschen Songpoeten verglichen. Hierzu dann ein kurzer Ausschnitt aus einem Musikvideo der auslaufenden 90er, in denen anbei noch lange nicht Blumfelds Spätwerk erreicht war, das derart dekontextualisiert natürlich einen schlageresken dümmlichen Eindruck macht: „Komm zu mir, in der Nacht – Wir halten uns umschlungen“ heißt es da. Man möchte augenscheinlich Kitscherei unterstellen. Nicht einmal liebevoll oder originell verrissen wird in dieser Dokumentation.
Neben Bernd Begemann sind es aber noch andere Protagonisten jener Strömung, die nicht einmal angerissen werden oder derer Name allerhöchstens einmal im Kontext irgendeiner Aufzählung „kam auch aus Bad Salzuflen“ genannt wird. Prominent werden die famosen Lassie Singers thematisiert, obwohl sie aus Berlin waren. Dann aber führt dies zu der Frage, was mit Jetzt! oder Mutter ist? Ganz persönlich fehlte mir Die Regierung, deren Sänger Tilman Rossmy alles andere als Zaungast der Gesamtbewegung war. Aber als Rezensent wie ein echauffierter Teenager seine Lieblingsband einzufordern, ist ein ziemlich larmoyanter Irrweg.
Nein, bei begrenzter Sendezeit und Budget ist es verständlich, dass nicht auch noch unbekanntere aber wichtige Bands wie Die Erde thematisiert werden. Es wäre jedoch mutiger gewesen, das schwerer zu entziffernde Material aus dem Untergrund zu besprechen oder es wenigstens einzuspielen, als zum x-ten Mal „Die Welt kann mich nicht mehr verstehen“ oder „Ich bin neu in der Hamburger Schule“ laufen zu lassen.
Gut und richtig ist der Wille, über Sexismus in dem bohemischen Lebensumfeld der Hamburger Schule zu sprechen. Und es dreht sich einem regelrecht der Magen um, wenn Bernadette La Hengst davon spricht, dass zu Beginn ihrer Karriere bei jedem zweiten Konzert „ausziehen“ gerufen wurde. Aber auch hier lässt das Format ein tieferes Interesse an der Thematik vermissen. Fanden diese Vorfälle auch in den einschlägigen Szeneclubs statt? Vielleicht gar im Kontext einer Support-Show für eine Männer-Band? Widerlich und untragbar auf jeden Fall, aber wie weit waren Protagonisten der Szene ganz unmittelbar beteiligt? Nein, es werden keine reißerischen Berichterstattungen erwartet, aber es verstört, dass solch wichtige Themen angerissen und anschließend der Fantasie überlassen werden. Warum wird hier nicht angemessen vertieft? („Lass uns über die Hamburger Schule reden“ (Ventil) sei an dieser Stelle empfohlen – ein Interview-Sammelband, der über jene Musikszene aus der Perspektive beteiligter Frauen erzählt).
Positiv zu betrachten ist jedenfalls das Mitwirken von Daniel Richter, der unter anderem etliche Artworks für Die Goldenen Zitronen gestaltet hat und dessen Karriere als angesehener bildender Künstler mit der Hamburger Schule verwurzelt ist. Er bringt noch einmal einen anderen Blick auf das Ganze mit und führt das Thema gewissermaßen weiter, auch ins Feld verschwisterter Kunstgattungen.
Wunderbar auch, wie Knarf Rellöm Kristof Schreuf zitiert und weiß, dass es nicht nur um den Text geht, sondern dass seine melodische und tonale Gestaltung ebenfalls essentiell ist: „Der Text ist meine Party, und mein Bild ist kein Messer“, singt der Diskurs-Paradiesvogel kurz an, worauf der Gründer von L’Age D’Or, Carol von Rautenkranz, im nächsten Schnitt die Kolossale-Jugend-Platte auflegt und jenes Zitat als „Absolut auf den Punkt gebracht“ feiert. Was das jetzt aber bedeutet… also… das wird Opa Günther, der durchs nächtliche Fernsehprogramm gezappt hat, nur begrenzt verstehen. Ähnlich wie… wir alle? Warum bitte wird hier nicht nachgehakt? Was hat Schreuf hier auf den Punkt gebracht? Geht es nicht viel mehr darum, ein vielleicht noch unbekanntes Gefühl durch Worte und Musik entstehen zu lassen, als darum, dass jemand etwas auf den Punkt bringt? Vielleicht auch Dialektik von Rautenkranz. Schlimm ist nur, wenn alle „so ist das nun mal“ nicken und es eben nicht ums Verstehen, sondern ums Erleben geht. Und natürlich ums, zumindest innerliche, Debattieren.
Alles in allem handelt es sich bei allem Wohlwollen um nicht viel mehr als eine Lifestyle-Dokumentation, die ziemlich austauschbar zu erzählen versucht, dass es eine verrückte Zeit war, in der alle kreativ unterwegs waren, im Angesicht einer nie enden wollenden Jugend. Siehe auch Studio 54, die 80er in West-Berlin oder was-weiß-ich-was-noch-alles.
„Hamburger Schule – Musikszene zwischen Pop und Politik“ verschenkt das große Potential, das die Interviewten hätten entfalten können, leichtfertig und lässt Schlüsselfiguren der Gesamtarchitektur sträflicherweise gleich nahezu komplett unerwähnt. Schade.
___
Edit: Inzwischen ist viel passiert. Den Stand zur aktuellen Debatte finden Sie hier.